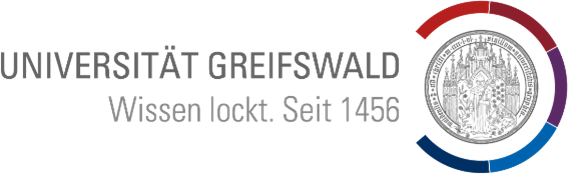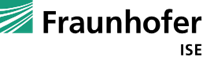MoorPower : Nachhaltige und Innovative Photovoltaik-Lösungen für wiedervernässte Moore

Teilprojekt: Wasser- und Nährstoffhaushalt, Spurenelemente, Torfeigenschaften
Gefördert durch: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)
Kooperationspartner: Universität Greifswald; Universität Hohenheim; Johann Heinrich von Thünen-Institut (Braunschweig); Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg)
Projektleitende/Verbundkoordinierende: Prof. Dr. J. Kreyling/Dr. Franziska Tanneberger
Teilprojektteam Angewandte Geologie: Prof. Dr. Andre Banning, M.Sc. Jovel Johnson
Laufzeit: 01.12.2024 – 30.06.2028
Hintergrund:
Torfkörper erbringen zahlreiche Ökosystemleistungen; sie speichern 30% des weltweiten Bodenkohlenstoffs, sind eine Senke für viele Nähr- und Schadstoffe, spielen eine entscheidende Rolle im Wasserkreislauf und beherbergen seltene und bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Die Kohlenstoffemissionen aus entwässerten Torfkörpern, die für die Land- und Forstwirtschaft genutzt werden, tragen in verschiedenen Ländern weltweit erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei, in Deutschland mit etwa 7 %. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen in Deutschland jährlich 50.000 ha derzeit entwässerter Moorflächen wiedervernässt werden. Für eine großflächige Wiedervernässung von Mooren sind besondere Maßnahmen erforderlich, die sozialverträglich und wirtschaftlich attraktiv sind, und eine alternative Nutzung der wiedervernässten Flächen (Stichwort Paludikultur) ermöglichen.
Ziel des Projekts:
Ziel des Forschungsprojektes MoorPower ist es, die technischen, ökologischen und sozio-ökonomischen Auswirkungen und rechtlichen Fragen der Kombination von Moorwiedervernässung und Photovoltaik (Moor-PV), auch in Kombination mit Paludikultur (Paludi-PV), umfassend zu analysieren und Empfehlungen für die konkrete Umsetzung von Moor-/Paludi-PV in Deutschland zu entwickeln.
Ziele des Teilprojektes:
Kartierung und Quantifizierung des Stoffinventars (u.a. Nährstoffe, redoxsensitive Spurenelemente mit toxikologischem Potenzial) im Torfkörper sowie Moor- und Grundwasser, zunächst im Ist-Zustand, dann vergleichend im Zielzustand der Wiedervernässung und Photovoltaik-Bebauung.
Tiefenorientierte Beprobung und Analyse der Feststoffe sowie des Moor-/Grundwassers. Untersuchung ausgewählter Torfproben in Säulenversuchen im unter Durchflussbedingungen und zur Simulation einer schrittweisen Wiedervernässung zur Charakterisierung von Stoffausträgen und Mobilisierungsprozessen.
Kombination von laboranalytischen Arbeiten mit hydrogeochemischen Modellierungsansätzen (Ist-Zustand, Soll-Zustand (hydrogeochemische Auswirkungen der Wiedervernässung), szenariobasierte Modellierung zukünftiger Entwicklungen zur Bewertung möglicher Nährstoff-/Spurenelementausträge auf abstromige Ökosysteme und Wasserressourcen.
Entwicklung einer integrierten Methodik, die Feld-, Labor- und Modellierungsmethoden umfasst, um das Verständnis von Prozessen und Systemen zu verbessern, die als Informationsgrundlage für wissenschaftliche und politische Entscheidungsträger dienen kann und ein hohes Potenzial zur Übertragung auf andere Standorte hat, sowohl als Werkzeugkasten als auch in den Ergebnissen selbst.
Projektpartner:
- Universität Greifswald: AG Experimentelle Pflanzenökologie (Prof. Dr. Jürgen Kreyling)
- AG Moorforschung (Prof. Dr. Gerald Jurasinski)
- AG Allgemeine Volkswirtschaftslehre und Landschaftsökonomie (Prof. Dr. Volker Beckmann)
- AG Mikrobiologie (Prof. Dr. Tim Urich)
- AG Angewandte Geologie (Prof. Dr. Andre Banning)
- Zoologisches Museum (Prof. Dr. Peter Michalik)
- AG Öffentliches Recht, insb. Verwaltungs- und Umweltrecht (Prof. Dr. Sabine Schlacke)
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Abteilung für PV Module und Kraftwerke Gruppe Agri-Photovoltaik (Agnes Wilke, Oliver Hörnle, Dr. Max Trommsdorff)
Universität Hohenheim Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Fg. Pflanzenökologie (Jun.-Prof. Dr. Andreas Schweiger)
Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institut für Agrarklimaschutz (Dr. Arndt Piayda, Dr. Bärbel Tiemeyer)